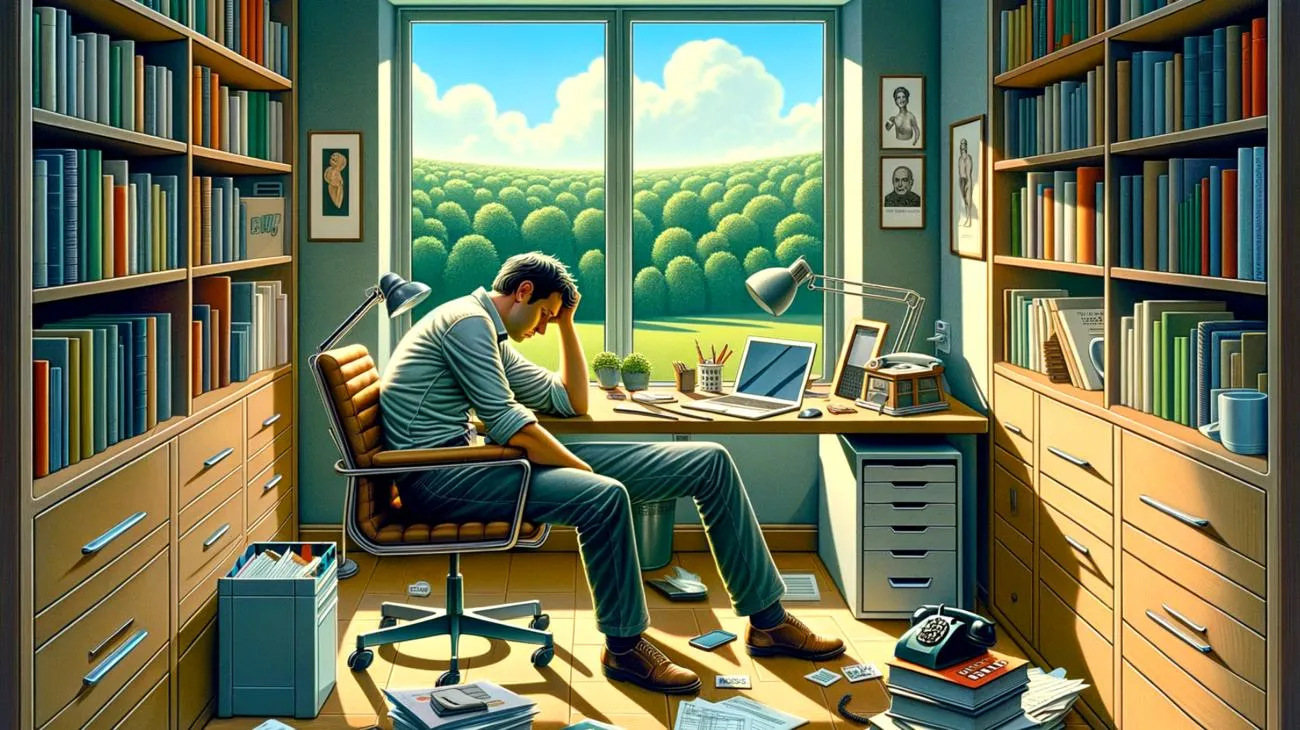Aufschieberitis? Was die Psychologie über dich verrät
Hand aufs Herz: Wann hast du das letzte Mal etwas Wichtiges vor dir hergeschoben? Die Steuererklärung? Den Anruf beim Zahnarzt? Oder vielleicht die Präsentation, die schon seit Wochen auf deinem Schreibtisch liegt? Falls du jetzt denkst: „Oh Gott, das bin ja ich!“, bist du definitiv nicht allein. Schätzungen zufolge leiden etwa 20 Prozent der Erwachsenen unter chronischer Prokrastination. Für Deutschland entspräche das rund 13 bis 15 Millionen Menschen.
Aber hier kommt die wirklich spannende Wendung: Was du vielleicht für Faulheit hältst, ist in Wahrheit etwas ganz anderes. Die moderne Psychologie zeigt, dass hinter dem Aufschieben oft keine Bequemlichkeit steckt, sondern emotionale Stressreaktionen – allen voran Angst.
Der große Mythos: Prokrastination ist nicht gleich Faulheit
Vergiss alles, was du über Aufschieberitis zu wissen glaubst. Dr. Tim Pychyl von der Carleton University hat in zahlreichen Studien belegt: Prokrastination ist in den meisten Fällen keine Folge von Faulheit, sondern eine Vermeidungsstrategie angesichts negativer Emotionen wie Unsicherheit, Überforderung oder Versagensangst.
Das erklärt auch, warum viele „Aufschieber“ in anderen Lebensbereichen sehr wohl produktiv sein können. Vielleicht kennst du jemanden, der die Wohnung perfekt reinigt, wenn eigentlich eine wichtige Aufgabe ansteht. Oder sich durch zehn Netflix-Folgen klickt, während ein dringender Bericht liegen bleibt. Das ist keine Trägheit – das ist aktive Emotionsregulation durch Vermeidung.
Was passiert wirklich in unserem Kopf?
Unser Gehirn ist biologisch darauf gepolt, uns vor Gefahren zu schützen. Wenn wir eine Aufgabe unterbewusst als bedrohlich wahrnehmen – zum Beispiel weil sie unser Selbstbild herausfordert oder Angst vor Kritik auslöst – springt unser limbisches System an. Besonders die Amygdala, unser emotionales Warnzentrum, wird aktiviert.
Das Problem dabei: Dieses evolutionsbasierte System unterscheidet nicht zuverlässig zwischen einer echten Bedrohung wie einem Raubtier und psychologisch belastenden Situationen. So werden selbst harmlose Aufgaben wie ein Telefonat oder eine E-Mail als „Gefahr“ eingestuft – und unser Gehirn startet die Vermeidung als Schutzmechanismus.
Die 5 häufigsten Ängste hinter der Aufschieberitis
Verschiedene Studien identifizieren fünf emotionale Grundmuster, die mit Prokrastination in Verbindung stehen. Erkennst du dich in einem davon wieder?
- Versagensangst: „Was, wenn ich schlecht bin?“ Diese Angst zählt zu den häufigsten Ursachen für Prokrastination. Menschen mit hoher Versagensangst verschieben Aufgaben, weil sie befürchten, ihre eigenen oder fremde Erwartungen nicht erfüllen zu können.
- Erfolgsangst: „Was, wenn ich zu gut bin?“ Klingt widersprüchlich – ist aber real. Manche Menschen scheuen vor den Konsequenzen des Erfolgs zurück.
- Kontrollangst: „Ich will selbst entscheiden!“ Prokrastination kann unbewusst als Strategie genutzt werden, sich Autonomie zurückzuholen.
- Bewertungsangst: „Was werden andere denken?“ Wer sich ständig fragt, wie die eigene Leistung ankommt, schiebt Aufgaben oft so weit wie möglich auf.
- Überforderungsangst: „Das schaffe ich nie!“ Manche Aufgaben fühlen sich so groß, komplex oder vage an, dass unser Gehirn auf Fluchtmodus umschaltet.
Warum uns das Verständnis für Prokrastination hilft
Die Erkenntnis, dass Prokrastination kein persönlicher Makel, sondern eine emotionale Schutzreaktion ist, verändert den Blick auf das eigene Verhalten grundlegend. Statt uns selbst als „faul“ oder „undiszipliniert“ abzuwerten, können wir beginnen, innezuhalten und zu fragen: „Welches Gefühl hält mich gerade zurück?“
Selbstmitgefühl spielt hier eine zentrale Rolle. Die Forscherin Kristin Neff hat in mehreren Studien belegt: Menschen, die sich selbst mit Mitgefühl begegnen – also Verständnis statt Verurteilung aufbringen –, neigen nachweislich seltener zu Prokrastination und haben eine stabilere psychische Gesundheit.
Der Unterschied zwischen Selbstmitgefühl und Selbstmitleid
Selbstmitgefühl bedeutet nicht, sich alles durchgehen zu lassen. Es heißt, die eigenen Unsicherheiten anzuerkennen und trotzdem Verantwortung zu übernehmen. Ein innerer Dialog kann so aussehen:
Statt: „Ich bin so dumm, dass ich das wieder aufgeschoben habe.“
Besser: „Ich merke, dass ich aufschiebe. Das passiert vielen Menschen. Was kann ich jetzt konkret tun?“
Praktische Strategien gegen angstbasierte Prokrastination
Wenn hinter dem Aufschieben emotionale Blockaden stecken, helfen keine starren To-Do-Listen, sondern Ansätze, die diese Ängste gezielt entschärfen. Hier sind fünf wirkungsvolle Methoden:
1. Die 2-Minuten-Regel
Nimm dir nur vor, zwei Minuten mit der Aufgabe zu beginnen. Diese niedrige Hürde reicht oft aus, den inneren Widerstand zu überwinden. Was dann passiert? Viele bleiben länger dran – weil das Anfangen oft der schwerste Teil ist.
2. Gefühle konkret benennen
Frag dich: Welche Emotion hält mich gerade zurück? Ist es Angst, Ärger, Scham? Studien zeigen, dass das bewusste Benennen negativer Gefühle deren Intensität senkt – und so die Entscheidungsfähigkeit verbessert.
3. Die Worst-Case-Analyse
Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Spiele das Szenario gedanklich durch. Oft wird klar: Selbst der schlechteste Ausgang wäre überlebbar. Diese kognitive Technik hilft, Ängste auf ein realistisches Maß zu bringen.
4. Aufgaben in Mini-Schritte aufteilen
Große, bedrohlich wirkende Projekte sollten in kleine, handhabbare Teilaufgaben zerlegt werden. Statt „Präsentation vorbereiten“ schreibst du: „10 Minuten Stichworte sammeln“, „erste Folie gestalten“, „Einleitung üben“ – je konkreter, desto machbarer.
5. Wenn-dann-Pläne setzen (Implementierungsintentionen)
Statt vager Vorsätze helfen klare Auslösereize: „Wenn ich morgen um 9 Uhr am Schreibtisch sitze, dann öffne ich als erstes das Projekt-Dokument.“ Studien zeigen, dass solche festen „Wenn-dann“-Verknüpfungen die Umsetzungschancen deutlich erhöhen.
Wenn Prokrastination zum Problem wird
Manchmal reicht Selbsthilfe nicht aus. Wenn das Aufschieben zum ständigen Begleiter wird und private oder berufliche Bereiche stark belastet, kann professionelle Unterstützung sinnvoll sein. Warnzeichen sind:
- Prokrastination besteht seit Jahren und scheint chronisch.
- Leistungsprobleme oder private Konflikte häufen sich.
- Gefühle wie Scham, Wertlosigkeit oder Überforderung dominieren.
- Selbst bei einfachsten Aufgaben fehlt jede Handlungsfähigkeit.
Kognitive Verhaltenstherapie hat sich als besonders wirksam bei tiefgreifender Prokrastination erwiesen. Entsprechende Spezialangebote gibt es inzwischen auch in Deutschland.
Der Blick nach vorn: Prokrastination als Chance verstehen
Aufschieben muss kein Gegner sein. Es ist oft ein wertvoller Hinweis: Wo du aufschiebst, da versteckt sich häufig eine emotionale Blockade – und genau dort liegt dein Entwicklungspotenzial. Wer lernt, nicht nur Aufgaben, sondern auch die darunterliegenden Gefühle anzugehen, erlebt echte Veränderung.
Ein neuer Umgang mit sich selbst
Statt dich beim nächsten Mal für deine Aufschieberitis zu schelten, sei neugierig: „Wovor will mich mein Gehirn gerade beschützen?“ Allein diese Haltung kann der erste Schritt zu mehr Selbstwirksamkeit sein.
Denn du bist nicht faul – du hast ein sensibles System, das gelernt hat, dich durch Vermeidung zu schützen. Und genau darin steckt die gute Nachricht: Wer das versteht, kann Stück für Stück ein neues Handeln lernen – bewusster, mitfühlender und kraftvoller.
Also wenn die Prokrastination das nächste Mal anklopft, frag nicht „Was stimmt nicht mit mir?“, sondern: „Was will mir meine Angst sagen?“ – und schau mal, wohin die Antwort dich führt.
Inhaltsverzeichnis